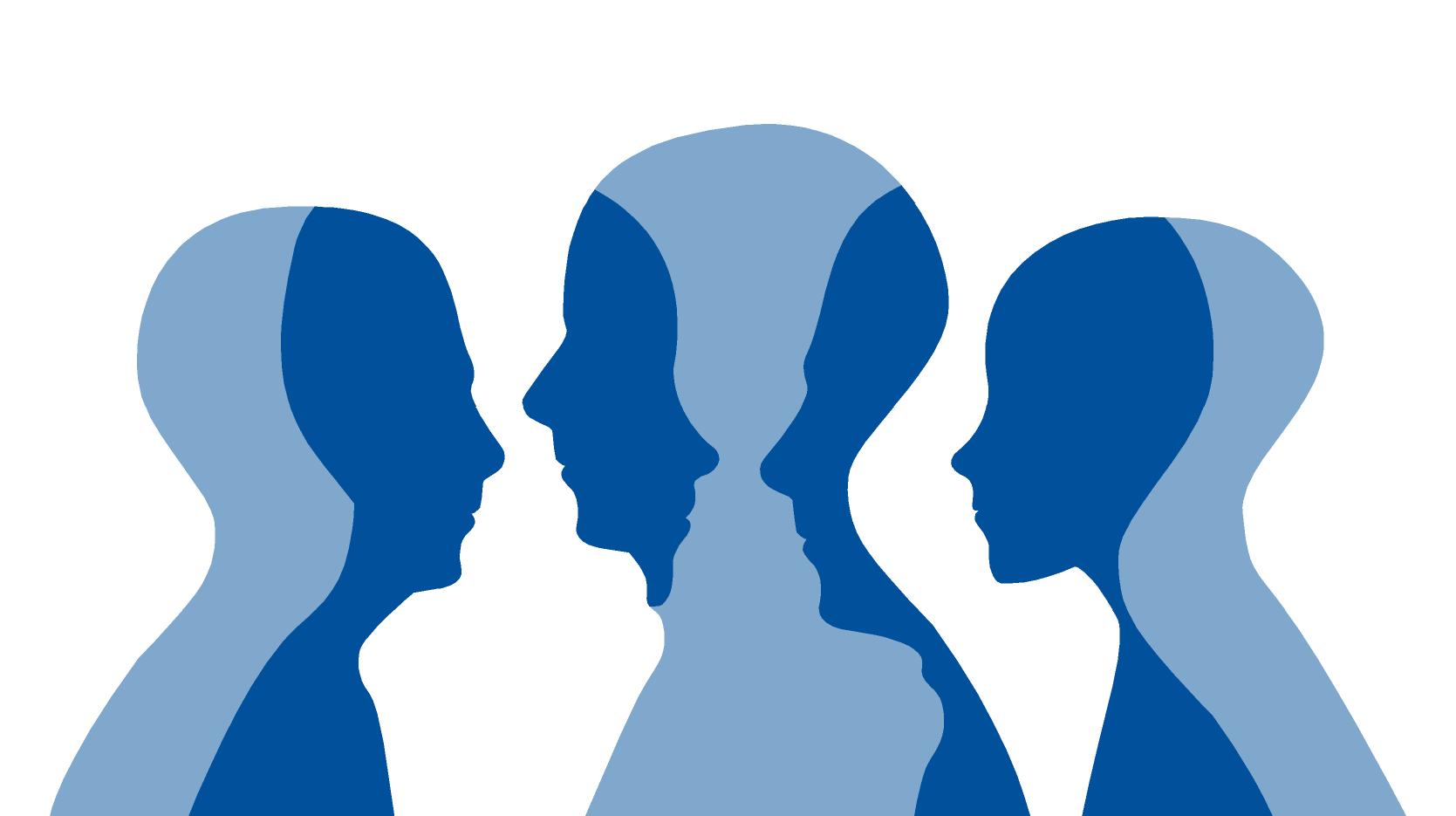Seit 2015 werden jährlich große Fortbildungstage für Erdkundelehrkräfte zusammen mit der Abteilung uniplus der Leibniz School of Education organisiert.
In diesem Rahmen werden Anregungen zur Thematisierung aktueller Themen und Debatten im Unterricht gegeben. Mit renommierten Referenten und Referentinnen wie Prof. Dr. Klaus Töpfer, Prof. Dr. Mojib Latif oder Luisa Neubauer erfreut sich diese Veranstaltungsreihe großer Resonanz.
Finanzielle Förderung kommt von Engagement Global gGmbH mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie der Verlagshäuser Klett und Westermann.